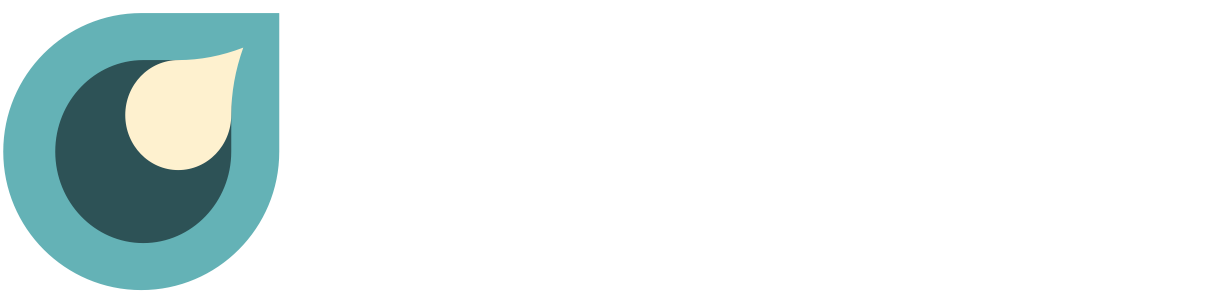Selbstbewusst und demütig – wie Frauen ihre Führung stärken, ohne sich größer machen zu müssen
Teil 5 der Blogserie „Female Leadership von innen heraus“
In dieser Serie geht es darum, wie Frauen heute führen – nicht durch Anpassung, sondern durch innere Klarheit, psychologische Tiefe und authentische Präsenz.
Teil 1 beleuchtete die innere Ausrichtung als Fundament weiblicher Führung. Teil 2 fragte, wie Vision entsteht – jenseits von Rollenbildern und Titeln. Teil 3 widmete sich dem Thema Beziehung: Wie gelingt Nähe, ohne sich selbst zu verlieren? Teil 4 zeigte, wie der Wechsel vom Tun zur Führung gelingt – mit einem CEO-Mindset von innen.
Jetzt geht es um Selbstwert, Präsenz und Demut – und darum, wie Frauen sich in ihrer Führung zeigen können, ohne sich zu inszenieren.
Selbstbewusst. Klar. Und verbunden.
„Ich will mich zeigen – aber ohne mich zu inszenieren.“
„Ich will führen – aber nicht so, wie ich es oft bei Männern gesehen habe.“
„Ich weiß, dass ich kompetent bin – aber manchmal fühlt es sich nicht so an.“
Diese Sätze fallen oft im Coaching, wenn Frauen beginnen, sich mit dem Thema Sichtbarkeit und Selbstbewusstsein auseinanderzusetzen. Sie haben viel erreicht, tragen Verantwortung, werden fachlich geschätzt – und zweifeln trotzdem an sich selbst. Nicht permanent. Aber regelmäßig. Und oft dann, wenn es um neue Rollen, öffentliche Wirkung oder das Einnehmen von Raum geht.
Dieses Phänomen ist kein persönliches Defizit. Es ist ein systemisches Echo. Es verweist auf Prägungen, auf Rollenerwartungen, auf die lange Geschichte weiblicher Selbstzurücknahme. Und es betrifft nicht nur Berufseinsteigerinnen – sondern gerade auch erfahrene Frauen, die plötzlich feststellen: Sichtbarkeit ist nicht einfach eine Technik. Es ist eine innere Erlaubnis.
Der stille Zweifel
Selbstzweifel sind leise. Sie melden sich nicht immer als deutlicher Gedanke. Manchmal zeigen sie sich als Zögern. Als inneres Zurücktreten. Als Vermeiden von Gelegenheiten, in denen man Position beziehen müsste. Als ständiges Überprüfen: War das zu viel? Hätte ich das anders sagen sollen? Hört man mir überhaupt zu?
Diese inneren Muster sind besonders verbreitet bei Frauen in Verantwortung, die hohe Ansprüche an sich selbst stellen, viel Verantwortung übernehmen und dabei gleichzeitig mit einem subtilen inneren Maßstab ringen: dem Ideal, alles richtig machen zu wollen – für andere, für die Organisation, für das größere Ganze.
Das Problem ist nicht das Selbstzweifeln an sich. Im Gegenteil: Wer sich selbst reflektiert, führt meist bewusster. Doch wenn der Zweifel die Handlung blockiert, wenn er zur inneren Schere wird, die Sätze vor dem Aussprechen zerschneidet, dann wird er zur Bremse. Und oft auch zur Quelle innerer Erschöpfung.
Was die Forschung zeigt
Das sogenannte Impostor-Phänomen ist gut erforscht. Es beschreibt das Gefühl, eigentlich nicht kompetent genug zu sein – trotz objektiver Erfolge. Untersuchungen zeigen, dass gerade hochqualifizierte Frauen besonders häufig betroffen sind¹.
Auch soziale Zuschreibungen spielen eine Rolle. Frauen, die sich sichtbar positionieren, laufen Gefahr, als dominant oder „zu ehrgeizig“ wahrgenommen zu werden² – ein doppelter Standard, der zu innerer Zurückhaltung führen kann.
Hinzu kommt ein gesellschaftliches Ideal von Weiblichkeit, das immer noch oft mit Bescheidenheit, Anpassungsfähigkeit und emotionaler Feinfühligkeit verknüpft ist. Wer sich zeigt, läuft Gefahr, „unweiblich“ zu wirken – und wer sich nicht zeigt, bleibt unter dem Radar.
Diese Ambivalenz erzeugt eine innere Spannung, die viele Frauen in sich tragen, oft ohne sie benennen zu können. Doch erst, wenn wir sie erkennen, können wir sie wandeln.
Der Unterschied zwischen Lautstärke und Präsenz
Viele Frauen glauben, sie müssten lauter werden, um gehört zu werden. Doch in Wahrheit geht es nicht um Lautstärke – sondern um innere Präsenz. Um das stille Wissen: Ich darf hier sein. Ich habe etwas zu sagen. Ich muss mich nicht rechtfertigen, um Raum einzunehmen.
In einem Coaching erzählte mir eine Klientin, dass sie bei jeder Vorstandssitzung innerlich mit sich kämpfte. Obwohl sie inhaltlich hervorragend vorbereitet war, fühlte sie sich wie eine Besucherin in einer Welt, in der sie sich fremd fühlte. Sie sprach wenig. Sie formulierte vorsichtig. Sie wartete, bis andere ihre Meinung geäußert hatten. Und hinterher ärgerte sie sich, dass sie sich wieder zu sehr zurückgenommen hatte.
Als wir tiefer arbeiteten, wurde klar: Sie glaubte, dass ihr Beitrag nur dann zählt, wenn er perfekt ist. Und sie glaubte, dass sie sich anpassen muss, um dazuzugehören. Beides waren Schutzstrategien. Verständlich – aber überholt.
Erst als sie begann, sich selbst die Erlaubnis zu geben, unvollkommen sichtbar zu sein, veränderte sich ihr Auftreten. Nicht laut. Nicht kämpferisch. Sondern klar. Selbstbewusst – und zugleich offen.
Selbstwert braucht keine Inszenierung
Ein starkes Selbstbewusstsein basiert nicht auf Behauptung. Es basiert auf Verbindung – mit dem eigenen Wert, mit der eigenen Erfahrung, mit dem, was durch uns in die Welt kommen möchte. Wer aus dieser Haltung spricht, wirkt. Nicht, weil sie sich durchsetzt. Sondern weil sie spürbar ist.
Diese Art von Selbstbewusstsein braucht keine Inszenierung. Sie braucht keine großen Gesten. Sie braucht ein inneres Wissen: Ich muss mich nicht beweisen – ich bin da.
Demut ist in diesem Zusammenhang kein Gegenpol zu Stärke. Im Gegenteil: Wer demütig ist, bleibt offen. Lernbereit. Beweglich. Doch Demut darf nicht zur Selbstverkleinerung werden. Sie ist kein Rückzug, sondern eine Haltung: Ich weiß, dass ich nicht alles weiß – und trotzdem habe ich etwas zu sagen.
Was wirklich trägt
In der aktuellen Führungsforschung wird immer wieder betont, dass Selbstreflexion, Lernfähigkeit und psychologische Sicherheit zu den wichtigsten Eigenschaften zukunftsfähiger Führungskräfte gehören³. Frauen bringen diese Qualitäten oft mit – sie müssen sich ihrer nur bewusst werden.
Eine meiner Klientinnen sagte einmal im Coaching: „Ich will nicht lernen, mich besser zu verkaufen. Ich will lernen, mich nicht mehr ständig zu hinterfragen.“
Genau das ist der Punkt. Es geht nicht um Selbstdarstellung. Es geht um Selbstklärung.
Und diese beginnt mit der Frage:
Was weiß ich über mich – jenseits von Rückmeldungen, Bewertungen und Erwartungen?
Wenn diese innere Klarheit da ist, entsteht ein anderes Selbstbewusstsein. Eines, das nicht kämpfen muss. Sondern wirkt. Authentisch. Leise. Und dennoch unübersehbar.
Fazit: Selbstbewusst UND demütig
Female Leadership braucht keine Pose. Sie braucht innere Verbindung. Selbstbewusstsein bedeutet nicht, alles zu wissen. Es bedeutet, sich selbst zu kennen – und auch dann zu sprechen, wenn nicht alles perfekt ist.
Demut bedeutet nicht, sich kleinzumachen. Sie bedeutet, Raum zu lassen – für Entwicklung, für andere, für neue Perspektiven. Und Selbstwert entsteht nicht aus Anerkennung von außen. Sondern aus dem Wissen: Ich darf da sein. Mit allem, was ich bin – und auch mit dem, was ich noch nicht bin.
Wenn Frauen diese Haltung kultivieren, entsteht eine neue Form von Führung. Eine, die nicht laut ist – aber tief. Nicht dominant – aber richtungsweisend. Und nicht perfekt – aber ganz.
📚 Quellen
¹ Clance, P. R., & Imes, S. A. (1978). The Impostor Phenomenon in High Achieving Women: Dynamics and Therapeutic Intervention. Psychotherapy: Theory, Research & Practice.
² Rudman, L. A., & Glick, P. (2001). Prescriptive Gender Stereotypes and Backlash Toward Agentic Women. Journal of Social Issues.
³ Center for Creative Leadership (2020). Future Fluency: How Strong Leaders Get There.